Die Übersetzer Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel
Die beiden bekannten Literaturübersetzer stellen sich und uns die Frage, in welcher Weise Literatur politisch sein kann und wie Übersetzer damit umgehen.
Frank Heibert stellt den US-Autor George Saunders vor, der politische Dystopien schreibt, zum Beispiel in seinem neuen Erzählband »Tag der Befreiung« oder dem jüngst auf Deutsch erschienenen Buch »Die kurze und furchterregende Regentschaft von Phil« - eine groteske, treffsichere und atemverschlagende Politparabel, die ‚furchterregend‘ zum amerikanischen Wahlkampf 2024 passte. Es ist, als hätte Saunders 2004, als er diese schrieb, schon Trump vorausgeahnt; Saunders spitzte damals die aktuelle Wirklichkeit in Richtung dystopischer Zukunft zu (vieles ist mittlerweile eingetroffen oder übertroffen). Er warnt uns durch Drastik, was bei ihm immer auch kombiniert ist mit seinem skurrilen und menschenfreundlichen Humor.
Kurz wird Frank Heibert auch auf seine Neuübersetzung von George Orwells dystopischem Klassiker »1984« (1949) eingehen. In solchen Romanen erleben wir Literatur in expliziter Weise politisch. Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel diskutieren auch, wie Übersetzer literarisch kraftvolle Texte übersetzen können, deren Autoren politisch fragwürdig sind. Hinrich Schmidt-Henkel hat beispielsweise 30 Jahre lang den berühmt-berüchtigten französischen Autor Louis-Ferdinand Céline übersetzt, als letztes »Tod auf Raten« (1936) und »Krieg« (1934). Werke, in denen Célines widerwärtiger Antisemitismus zwar noch nicht zu spüren ist, aber der Übersetzer, der sich den Blick des Autors auf die Welt beim Übersetzen zu eigen machen muss, weiß ja dennoch, wer hier spricht. Hinrich Schmidt-Henkel wird uns präsentieren, wie sein Céline auf Deutsch klingt.
Wie dieses Problem von notwendiger Nähe und notwendiger Distanz bei der Arbeit zu handhaben ist, davon werden beide berichten. Auch Frank Heibert hatte einen in dieser Hinsicht schwierigen Autor zu übersetzen, den Italiener Curzio Malaparte mit seinem Antikriegsroman »Die Haut« (1949).

© Christa Holka
Frank Heibert
Frank Heibert, geboren 1960 in Essen, ist Jazzmusiker und Übersetzer. Er übersetzt aus dem Englischen, Französischen, Italienischen und Portugiesischen, u. a. William Faulkner, Don DeLillo, Richard Ford, Yasmina Reza, Boris Vian und Aldo Busi. Er wurde mit dem Ledig-Rowohlt-Preis für literarische Übersetzer, dem Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis und dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW ausgezeichnet.

© Gorm K. Gaare
Hinrich Schmidt-Henkel
Hinrich Schmidt-Henkel, geboren 1959, lebt in Berlin. Er übersetzt u.a. auch Jean Echenoz, Édouard Louis, Jon Fosse, Tomas Espedal und Tarjei Vesaas. Ausgezeichnet wurde er u. a. mit dem Jane Scatcherd-Preis, dem Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds und dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW (zusammen mit Frank Heibert).

George Saunders »Die kurze und furchterregende Regentschaft von Phil«
Willkommen in Innen-Horner, einem Land, das so klein ist, dass darin nur eine einzelne Person Platz hat. Der Rest der Bevölkerung muss in der Kurzzeitaufenthaltszone des umliegenden Landes Außen-Horner warten, bis getauscht wird – so haben es die sonderbaren, nicht ganz menschlichen Bürgerinnen und Bürger des Landes vereinbart. Doch als Innen-Horner eines Tages plötzlich schrumpft und drei Viertel seines aktuellen Bewohners über die Grenze in das Gebiet von Außen-Horner ragen, sehen die Außen-Horneriten eine Invasion im Gange und geraten in den Bann des machthungrigen und autoritären Phil. Es ist der Beginn seiner kurzen, dafür umso schrecklicheren Regentschaft…
George Saunders erzählt mit unvergleichlichem Witz eine zutiefst seltsame und doch seltsam vertraute Geschichte über Macht und Ohnmacht und die ewig verführerische Kraft der Demagogie – ein „Animal Farm“ für unsere Zeit.
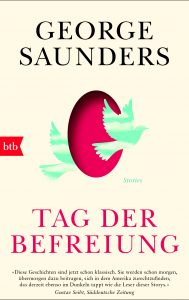
George Saunders »Tag der Befreiung«
»Tag der Befreiung« versammelt so virtuose wie einfühlsame Erzählungen über die Gefängnisse, in denen wir stecken, die ganz realen und die eingebildeten. Sie handeln von Macht und Moral, Liebe und Verlust, von der Sehnsucht nach menschlicher Verbindung und dem Versuch, sich von allem zu befreien. Und davon, dass die Befreiung manchmal die noch größere Katastrophe ist.
George Saunders erzählt mir großer Klarsicht von einer zutiefst verunsicherten Gesellschaft: Da ist der Großvater, der in einer nicht allzu fernen dystopischen Zukunft einen Brief mit einer zärtlichen Warnung an seinen Enkel schreibt. Oder die Mutter, die ein Unrecht an ihrem Sohn sühnen möchte, dabei jedoch nur noch größeres Unrecht verursacht. Oder der Obdachlose, der sich zu einer Gehirnwäsche bereiterklärt und doch eingeholt wird von seinem früheren Leben. Oder der unterirdische Vergnügungspark, in dem Hölle gespielt wird und der alles auf die Probe stellt, was wir für die Wirklichkeit halten…
 Louis-Ferdinand Céline »Krieg«
Louis-Ferdinand Céline »Krieg«
Flandern im Herbst 1914. Gleich zu Beginn des Kriegs wird der junge Soldat Ferdinand schwer verwundet. Unter furchtbaren Bedingungen operiert, kommt er halb tot ins Militärkrankenhaus, wo eine Krankenschwester ihn pflegt, die ihn sexuell so anzieht wie er umgekehrt sie. Das Rauschen im Ohr raubt Ferdinand den Schlaf, viel schlimmer aber sind die Bilder im Kopf. Zurück im Leben, freundet er sich mit dem Zuhälter Bébert an und gibt sich zügellosem Vergnügen hin. Er überlistet den Tod, befreit sich von dem Schicksal, das ihm bestimmt war.
Die betäubende Gleichzeitigkeit von Kriegsgrauen, Naturschönheit, menschlicher Verrohung, Zynismus und Liebessehnsucht macht die Einzigartigkeit dieses Buches aus. Ein unvergesslicher Roman über die Hölle, die die Menschen sich gegenseitig bereiten.
In Kooperation mit dem Verein Lese-Kultur Godesberg und dem katholischen Bildungsforum Bonn


